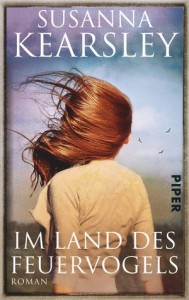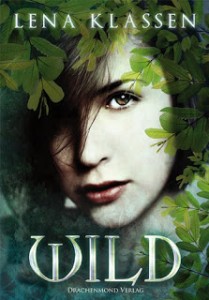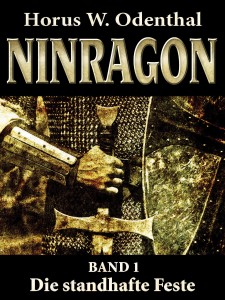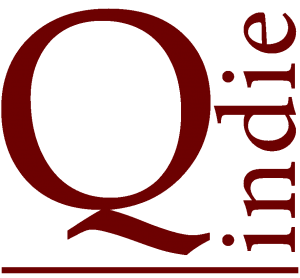Spiegelblut, Spiegelseele, Engelskind: alles unterschiedliche Bezeichnungen ein und desselben Phänomens. Und dieses Phänomen ist Coco Lavie, Protagonistin in Uta Maiers gleichnamigen Roman-Neuling. Ein Buch, das überrascht und begeistert mit seiner geheimnisvollen und unerwartet komplexen Fantasy-Welt. Für scriba das Lese-Highlight des Herbstes. Im Interview verrät uns die Autorin mehr über sich und ihr zweiteiliges Werk.

scriba: „Coco Lavie – Spiegelblut“ ist bisher ausschließlich als E-book durch den Aeternica Verlag veröffentlicht worden. Ist eine Printversion geplant? Wenn nicht, warum hast du dich für diesen eher ungewöhnlichen Weg entschieden?
Uta Maier: Die Printversion ist mittlerweile erschienen. Mir war es wichtig, dass man das Buch auch als Printausgabe bekommen kann, denn es gibt immer noch Kindle-Verweigerer. Obwohl Aeternica sich hauptsächlich auf E-Books spezialisiert hat, bietet der Verleger, Michael Till-Lambrecht, einigen Autoren auch die Möglichkeit einer Printausgabe an. Wie das im Einzelfall gehandhabt wird, hängt allerdings auch vom Autor ab. Mein wichtigstes Kriterium an die Printausgabe war der Preis. Die Printausgabe sollte nicht zu teuer sein.
scriba: Die Vampir-Thematik ist nicht neu. Ungewöhnlich ist jedoch die ausgefeilte Fantasy-Welt, die du in Coco Lavie erschaffen hast. Der Leser bestaunt und erlebt einen eigenen bis aufs Kleinste ausgearbeiteten Kosmos, bei dem es sich durchaus empfiehlt, aufmerksam zu lesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Wie ist diese komplexe Welt entstanden? Hast du im Vorfeld lange recherchiert und sie beim Schreiben nach und nach ausgearbeitet? Was war die zündende Idee?
Uta Maier: Mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass die Welt, die ich gestrickt habe, sehr komplex ist. Das ergab sich einfach beim Schreiben, außerdem wollte ich es irgendwie schaffen, Engel und Vampire logisch zu verknüpfen. Dafür waren eben viele Ausfeilungen nötig. Meine größte Befürchtung war anschließend, dass die Leser diese Welt nicht verstehen und daher der Geschichte nicht folgen können. An dieser Stelle muss ich meinen vier Testlesern noch einmal danken. Anhand ihrer Reaktionen habe ich gesehen, wo es zu viel des Guten war. Eine zündende Idee als solche gab es nicht.
scriba: Auch die Figuren in deiner Geschichte sind durchweg ausgefeilt und bunt, ob das jetzt Coco oder die einzelnen Vampire wie Pontus, Damontez oder Remo sind. Legst du bestimmte Charaktereigenschaften von Beginn an fest oder verselbständigen sich die Charaktere beim Schreiben?
Uta Maier: Das fragt man Autoren im Allgemeinen gerne. Und ich würde wirklich gerne außergewöhnlich darauf antworten, aber ich denke, es ist bei mir ähnlich wie bei meinen Kollegen. Manches ist von vornherein festgelegt, manches ergibt sich. Coco zum Beispiel machte mir überhaupt keine Probleme. Ihr Charakter war sofort klar, auch ihre Art zu handeln. Vieles ergab sich auch aufgrund ihrer Vergangenheit. Auch Pontus, der sehnsuchtsvolle und vom ewigen Leben geplagte Vampir, hat sich mir relativ schnell erschlossen. Vielleicht waren diese beiden Figuren auch deshalb so klar, weil sie jeweils eine eigene Perspektive haben, so habe ich das, was eventuell noch fehlte, schnell zwischen den Zeilen gefunden. Damontez war die schwierigste Figur in diesem Buch, vielleicht gerade deswegen, weil er keine eigene Erzählperspektive hat. Das habe ich aber bewusst so gewählt, denn so bleibt er geheimnisvoll, man erfährt nicht, was er denkt, und erlebt ihn nur aus Cocos Sicht. Auf alle Fälle wollte ich das Klischee des netten Vampirs von nebenan vermeiden. Die Seelenbeziehung von Remo und Damontez war die nächste Herausforderung. In Teil II wird Remo eine bedeutendere Rolle bekommen und mit ihm erfährt man gleich auch wieder etwas über seinen Seelenbruder Damontez. Sie sind für mich im Grunde nur als Einheit zu begreifen, was es für mich anfangs vielleicht auch so schwierig gemacht hat, die Figur des Damontez in Teil I zu verstehen.
 scriba: In diesem Zusammenhang ist auch interessant: Hast du einen „Lieblingsvampir“ unter deinen Figuren?
scriba: In diesem Zusammenhang ist auch interessant: Hast du einen „Lieblingsvampir“ unter deinen Figuren?
Uta Maier: Ganz schwierige Frage! Anfangs war es sicherlich Pontus. Ich mag seine Art zu leiden und sich zu sehnen. Letztendlich wurde er aber irgendwann von Damontez überholt. Den Zeitpunkt, wann das passiert ist, weiß ich jedoch nicht mehr.
scriba: Coco Lavie ist im September erscheinen. Wie ist das Feedback der Leser?
Uta Maier: Eigentlich durchweg positiv. Ich kann es aber fast nur anhand von Rezensionen bei Amazon beurteilen, und die sind bislang gut. Natürlich wurde Coco das Stockholmsyndrom unterstellt, aber wenn man genau liest und sich auf Damontez und Coco einlässt, sollte man wissen, dass dem nicht so ist.
scriba: Coco Lavie ist nicht dein Debütroman, sondern du hast davor schon mehrere Bücher veröffentlicht. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung beim Schreiben eines Romans? Oder anders gesagt: Ist jedes Buch eine gleich große Herausforderung? Fällt dir das Schreiben mit wachsender Erfahrung immer leichter?
Uta Maier: Das Schreiben an sich wird definitiv leichter. Heute muss ich mir kaum noch Gedanken über Formulierungen machen und kann relativ schnell auch schwierige Szenen schreiben. Da meine Bücher immer sehr komplex sind, ist es jedes Mal eine der größten Herausforderungen, das Thema trotzdem verständlich an den Leser zu bringen. Jedes Buch hat natürlich andere Knackpunkte. Bei „Coco Lavie – Spiegelblut“ war es Damontez und seine Seelenbeziehung zu Remo, und natürlich das Thema der Seelentrennung an sich. Wenn etwas schon so wenig definierbar ist wie die Seele, ist es schwierig, Konkretes darüber zu schreiben, ohne dass es unglaubwürdig wirkt.
Ich merke mittlerweile auch, dass es mir zunehmend leichter fällt, die Geschichte sich selbst erzählen zu lassen. Ich brauche eine Grundidee und ein paar Fakten, den Schluss und natürlich ein oder zwei Hauptfiguren. Die Inspiration kommt beim Schreiben. Da bewirkt das Unterbewusstsein ganz viel. Die besten Ideen, solche bei denen man auf die Knie fallen möchte oder einfach das Fenster aufreißen will, um es hinauszuschreien, entstehen bei mir nur im Fluss. Allerdings muss ich gestehen, dass das Drei-Akt-Modell und Papyrus Autor, zusätzlich zum Unterbewusstsein, nennenswerte Hilfen sind.
scriba: Was für ein Schreibtyp bist du? Eher der intuitive Schreiber oder folgst du einem genauen Plan?
Uta Maier: Oh … da habe ich eben wohl vorgegriffen. Um es auf den Punkt zu bringen. Ich brauche beides. Intuition und Plan. Wobei der Plan nicht zu straff sein darf, denn sonst macht es keinen Spaß. Ich brauche die Figuren, den Konflikt, das Thema und vor allem das Ende. Was wie und wann passiert, entscheide ich meist nur grob, der Rest ergibt sich spontan beim Schreiben. Es muss nur auf das Ende hinarbeiten. Wenn jemand intuitiv schreibt, hält er das Drei-Akt-Modell oder die Heldenreise sowieso ein. Denn die ersten Geschichten dieser Erde entstanden auch ohne diese Schablonen und ganz sicher würde man diese Grundmuster auch in denen finden. Das hat wohl irgendwie mit den Archetypen zu tun, also den menschlichen Urbildern und Vorstellungen, die uns allen gemein sind, aber genau kann ich es auch nicht erklären, da müsste man wohl einen Psychologen fragen. Aber wer sich auf seine Intuition verlässt, liegt meist richtig.
scriba: Nehmen wir mal an, die Coco-Lavie-Reihe würde verfilmt: Wer sollten dann die Hauptdarsteller sein?
Uta Maier: Ich habe so lange gewartet, dass mich das jemand zu den Hauptfiguren von „Triklin“ fragt. Da hätte ich nämlich schon die komplette Besetzung parat. Für Coco Lavie könnte ich nur Damontez benennen: Ben Barnes – aber bitte nur mit langen Haaren!
scriba: Wie lange hast du an der Geschichte um Coco Lavie geschrieben? Gab es auch zähe Schreib-Episoden und gestrichene Szenen?
Uta Maier: Um ehrlich zu sein, habe ich für Coco Lavie zwei Manuskripte mit jeweils 400 Seiten wieder verworfen (was hauptsächlich Damontez‘ Schuld war, denn er war anfangs zu schnell zu nett). Deshalb hat es auch zwei Jahre gedauert, von denen man aber fast eineinhalb abziehen kann. Außerdem hatte ich zwischendurch auch einige Lektorate, sodass ich nie so zum Schreiben kam, wie ich wollte. Das Manuskript, so wie es jetzt ist, entstand dann relativ schnell. Ich glaube, die letzten 120 Seiten habe ich in zwei Wochen geschrieben. Allerdings bedurften die hinterher auch einer gründlichen Überarbeitung. Aber von der allerersten Idee bis zur Veröffentlichung waren es sicher zwei Jahre. Mein Problem war das Ende von Teil I. Ich hatte nur das Ende von Teil II im Kopf. Das war etwas schwierig, denn im Grunde ist es kein wirklicher Zweiteiler, ich habe die Geschichte künstlich unterbrochen.
scriba: Wo holst du dir die Motivation zum Durchhalten bei der langen und doch von der Außenwelt isolierenden Schreib-Phase eines Buchprojekts?
Uta Maier: Ich liebe das Isolieren eigentlich. An kaum einem Ort bin ich so entspannt wie vor meinem Laptop. Hier ruhe ich in mir selbst. Motivation hole ich mir wie Coco aus der Musik. Dabei höre ich auch wirklich alles. Klassik und Mainstream.
scriba: Am Ende des Romans findet der Leser eine Anzahl von Literaturtipps. Wir sind neugierig: Welches Buch hat dich 2013 am meisten beeindruckt?
Uta Maier: Ganz ehrlich? Es war das Kinderbuch „Ente, Tod und Tulpe“ von Wolf Erlbruch.
scriba: Zu guter Letzt die Frage, die viele Leser brennend interessieren dürfte: Wann erscheint „Coco Lavie – Nachtschattenherz“? Auf deiner Homepage steht, der 2. Teil ist bereits im Lektorat …
Uta Maier: Im Lektorat ist es noch nicht, aber auf dem Weg dorthin. Momentan liegt es bei meinem Verleger mehr oder weniger brach, aber dieses Wochenende wollte er es sich anschauen. Wenn er sein Okay gibt, geht es ins Lektorat. Daher kann ich leider kein konkretes Datum nennen. Ich hoffe natürlich, dass es so bald wie möglich ist.
Die gesamte scriba-Redaktion dankt Uta Maier herzlich für das interessante Interview! Hier könnt ihr die Rezension zu „Coco Lavie – Spiegelblut“, dem Auftaktroman des Zweiteilers, lesen.